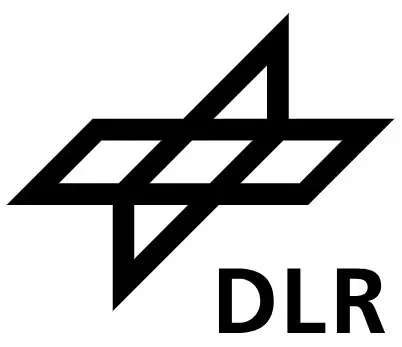Richtlinie zur Lohntransparenz erzeugt Handlungsbedarf
Auskunftspflicht. Ab nächstem Jahr können Mitarbeiter und Bewerber die Gehaltsstrukturen von Arbeitgebern erfragen. Im Vorteil ist, wer schon jetzt Lohnunterschiede ausgleicht.

In weniger als zwölf Monaten greifen die Regelungen der Entgelttransparenzrichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates. Sie sollen großen Gehaltsscheren innerhalb eines Berufsbildes oder gar eines Unternehmens entgegenwirken. Mitarbeiter bekommen ein Recht darauf, zu erfahren, wie viel ihre Kollegen mit vergleichbarem Aufgabenfeld und Verantwortung verdienen, und zwar unabhängig von Geschlecht und Alter. Auf die vielen mittelständischen Firmen in der Immobilienwirtschaft sehen die Anwältin Sonja Riedemann und ihre ESG-Kollegen von der Kanzlei Osborne Clarke drei wesentliche Verschärfungen (siehe Infokasten „Neue EU-Richtlinie greift ab Sommer 2026“) zukommen. Die Arbeitsrechtlerin rät schon jetzt, das laufende Jahr 2025 für eine Analyse des Status quo und vorausschauende Lohnanpassungen zu nutzen, „um bereits rechtzeitig eventuell zu Tage tretende Entgeltdifferenzen noch verringern zu können.“
Dieser Schritt lohnt sich laut Doreen von Bodecker, Geschäftsführerin der Personalberatung Cobalt in Deutschland, vor allem für kleinere und mittelständische Firmen. Denn dort haben die meisten Angestellten beim Einstieg ein individuelles Gehalt für sich ausgehandelt. Nach von Bodeckers Beobachtungen wurden diese Löhne in den vergangenen Jahren kaum angepasst. „Nicht selten verdient ein Experte mit jahrelanger Unternehmenszugehörigkeit deshalb weniger als der neue Kollege, der erst vor kurzem ins Team geholt wurde, aber für seinen Wechsel höhere Ansprüche an die Bezahlung gestellt hat.“ Einsicht in die Gehaltsstrukturen konnten Mitarbeiter bisher nur in Unternehmen mit mehr als 200 Angestellten erhalten. Doch auch diese Firmen fanden je nach Aufbau Schlupflöcher, um eine Offenlegung zu umgehen, sagt von Bodecker. „Firmenstrukturen mit Tochtergesellschaften ermöglichten trotz höherer Gesamtmitarbeiterzahl zu argumentieren, dass die Angestelltenzahl innerhalb einer Tochter niedriger ist“, erläutert sie.
Durch die kommende Auskunftspflicht, die dann auch für Kleinstunternehmen gilt, sieht die Personalberaterin zwei Gefahren auf die Arbeitgeber zukommen. Zum einen könnten sich bestehende Mitarbeiter gegenüber ihren Kollegen benachteiligt fühlen, wenn sie merken, dass ihr Gehalt niedriger liegt. Zum anderen könnten Wettbewerber die Mitarbeiter zu einem Wechselwunsch anregen, wenn sie mit höheren Löhnen für offene Stellen bei sich werben. „Große Konzerne sind bereits in der Vorbereitung“, sagt von Bodecker und nennt FM-Anbieter als Beispiel. „Sie sind margenorientiert und zahlen daher schon länger einheitlichere Gehälter.“ Dass sie mit ihren Löhnen künftig offensiv im Rahmen des Employer-Brandings werben, schließt von Bodecker nicht aus.
Um den eigenen Mitarbeitern zu signalisieren, dass ein Bestreben nach einheitlicher Bezahlung besteht, können Arbeitgeber laut von Bodecker schon jetzt erste Schritte einleiten. „Dafür müssen Gruppen innerhalb eines Unternehmens oder einer Abteilung definiert werden, um Angestellte nach Aufgaben, Position und Unternehmenszugehörigkeit vergleichbar zu machen“, erklärt sie.
Wer Fixgehälter nicht auf einen Schlag erhöhen kann, weil das die Budgets für Personalkosten sprengen würde, könne auch andere Wege gehen. „Etwa durch Inflationsausgleiche, neue Bonuspakete, die Mitarbeiter an ihren Erfolgen beteiligen, und vor allem durch genaues Überlegen, welche Sonderaufgaben ein Mitarbeiter hat, die einen höheren Lohn für ihn rechtfertigen.“ Weil auch Benefits zum Gehaltspaket zählen, sollten auch Posten wie Firmenwagen oder Möglichkeiten für flexibles Arbeiten genau mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter abgeglichen werden. „Am Ende“, das betont die Personalberaterin, „zählen aber auch die nicht-monetären USPs in einem Unternehmen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu binden.“ Dazu gehören ein guter Teamzusammenhalt, ein kooperativer Führungsstil, der auf Fördern und Fordern basiert, sowie langfristige Jobaussichten.“
Gerade letztere sollten Arbeitgeber nutzen, um mit Blick auf die Zukunft ihre Gehaltspolitik einschließlich zukünftiger Anpassungen zu überdenken. „Ein Mitarbeiter, der in seinem Job und dem Umfeld zufrieden ist und der eine Zukunft für sich im Unternehmen sieht, schaut sich die Gehälter bei anderen erst gar nicht an“, glaubt von Bodecker. Nicht zuletzt könnte die Offenlegung von Gehältern diejenigen Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter an sich binden können, in Zukunft auch vor überhöhten Forderungen von neuen Kandidaten schützen. „Zu wissen, was die Konkurrenz zahlt, kann auch Grenzen für Berufsbilder festlegen und somit die Ansprüche von Bewerbern regulieren. Dadurch können sich Arbeitgeber bei Einstellungsentscheidungen wieder stärker darauf konzentrieren, welches Skillset ein Kandidat mitbringt und wie gut er ins Team passt. Gehalt und Expertise werden so in Relation gebracht.“
Ab dem 7. Juni 2026 gilt in Deutschland die Entgelttransparenzrichtlinie (EntgTrRL) des Europäischen Parlaments und des Rats, die am 10. Mai 2023 beschlossen wurde. Sie führt zu Anpassungen des bisher in Deutschland gültigen Entgelttransparenzgesetzes (EntgeltTranspG), das am 30. Juni 2017 in Kraft trat. Die Richtlinie sieht vor, dass Mitarbeiter schon im Bewerbungsprozess die Durchschnittsgehälter in einem Unternehmen für eine bestimmte Position erfragen können, auch wenn dort weniger als 200 Angestellte beschäftigt sind. Auf Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern kommt eine Berichtspflicht zu ihren Entgeltstrukturen zu. Bei Verstößen gegen die Auflagen drohen Bußgelder. Sie können zudem dem Image eines Unternehmens als Arbeitgeber schaden. Außerdem können Arbeitnehmer Schadenersatzansprüche geltend machen, wenn ihnen durch die Verletzung der Transparenzanforderungen ein finanzieller Schaden entstanden ist.
Janina Stadel
Aktuelle Top-Jobs

Mitarbeiterin / Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung) (w/m/d)

Technischer Property Manager (w/m/d)

Leitung des Betriebsbereiches „Münster“ des Bundesforstbetriebes Rhein-Weser (w/m/d)

Bürosachbearbeiterinnen / Bürosachbearbeiter (m/w/d) im Facility Management